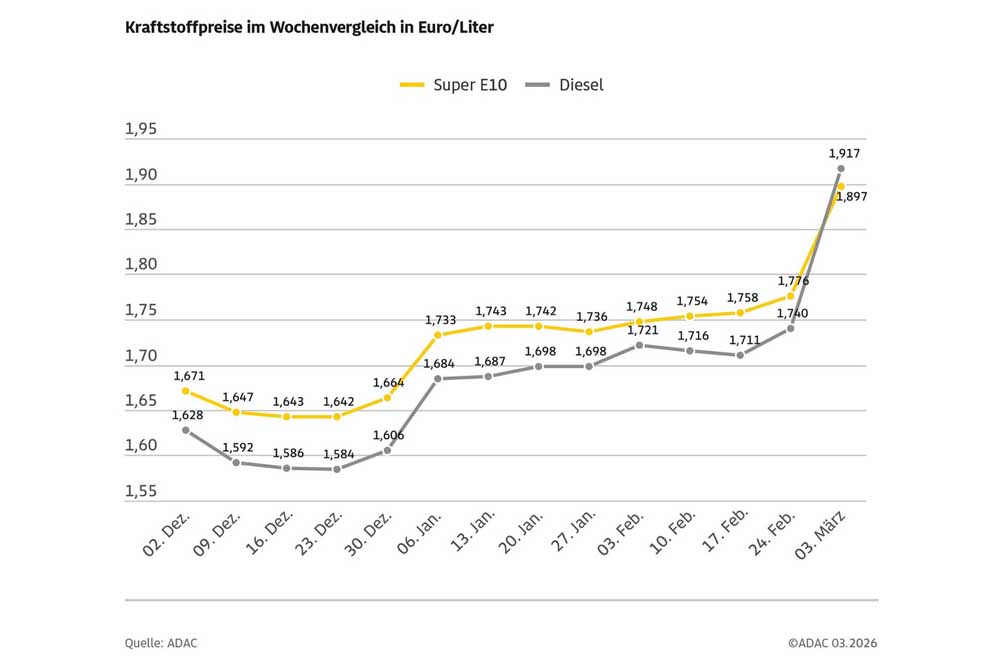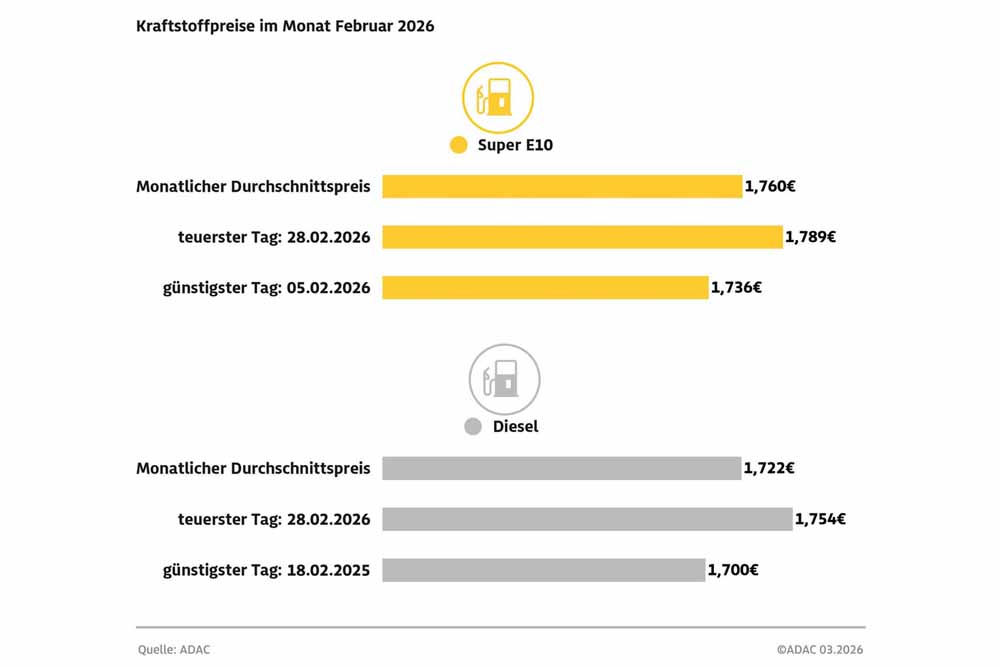Die Menschen in Deutschland können ihre Bereitschaft zur Organspende seit Montag in einem zentralen Register im Internet hinterlegen. Das neue Organspende-Register solle schrittweise den bisherigen Spenderausweis in Papierform ablösen und die Zahl der dringend benötigten Spenden erhöhen, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montag. Angesichts des anhaltenden Mangels an Spenderorganen forderte Lauterbach zugleich aber deutlich weitergehende gesetzliche Maßnahmen.
Anlässlich des Starts des neuen Portals richtete der Minister einen Appell an die Bürgerinnen und Bürger: „Fassen Sie eine Entscheidung zur Organspende und halten Sie diese im Register fest!“ Der Eintrag dort ist laut Bundesgesundheitsministerium freiwillig und kostenlos. Er kann vom Eintragenden jederzeit wieder geändert oder gelöscht werden.
Lauterbach bezeichnete das Register als „wichtigen Meilenstein, um mehr Organspende möglich zu machen“ – und machte zugleich deutlich, dass ihn dieser Schritt noch nicht zufrieden stellt. Er gehe davon aus, „dass wir langfristig die Zahl der Organspenden nur erhöhen können, indem wir die Widerspruchslösung einführen“, sagte der SPD-Politiker.
Eine solche Lösung sähe vor, dass grundsätzliche jeder Mensch in Deutschland gesetzlich zur Organspenderin oder zum Organspender erklärt wird – und aktiv seinen Widerspruch dagegen einlegen muss, sollte er damit nicht einverstanden sein. ,Für eine derartige Regelung hatte es allerdings bei der Abstimmung im Bundestag 2020 keine Mehrheit gegeben. Verabschiedet wurde damals das Modell zur so genannten Entscheidungslösung: Das heißt, jeder Mensch soll von sich aus dokumentieren, ob er Organe spenden will oder nicht.
„Wir haben weiterhin eine sehr schwierige Situation“, sagte Lauterbach. „Die Zahl der Organspender, die registriert sind oder den Ausweis haben, bleibt weit hinter dem zurück, was wir benötigen“, betonte er. Derzeit seien 8400 Menschen auf der Warteliste für eine Organspende verzeichnet, pro Jahr würden aber nur rund 900 Organe verpflanzt.
Die Einführung des am Montag freigeschalteten Portals erfolgt schrittweise: Zunächst ist es nur möglich, eine Erklärung für oder gegen die Organspende mit Hilfe eines Ausweisdokuments mit eID-Funktion zu hinterlegen, zum Beispiel mit einem Personalausweis.
Später soll die Registrierung auch mittels einer Gesundheits-ID möglich sein, welche die Versicherten von ihrer Krankenkassen bekommen. Ab dem 1. Juli sollen die Krankenhäuser in der Lage sein, die Erklärungen abzurufen – und dann im medizinischen Ernstfall ein Organ zu transplantieren.
Bislang bekam jeder Krankenversicherte ab dem 16. Lebensjahr von seiner Krankenkasse regelmäßig Informationsmaterial, anhand dessen er sich für oder gegen eine Organ- und Gewebespende nach dem Hirntod entscheiden kann. Lauterbach empfahl am Montag, den Spenderausweis weiter mit sich zu führen, bis das neue Onlineregister voll funktionsfähig ist.
Den Start des Onlineregisters würdigte Lauterbach als „Meilenstein für Digitalisierung“. „Die Angehörigen werden entlastet, aber auch die Ärztinnen und Ärzte.“ Im medizinischen Notfall könnten die Krankenhäuser nun „durch den Blick ins Organspenderegister“ Gewissheit über die Spendenbereitschaft erreichen.
Der Gesundheitsminister verwies darauf, dass das neue Onlineregister für den Fall der Einführung einer Widerspruchslösung weiterentwickelt werden könne. „Das Register ist eine gute Vorarbeit für die Widerspruchslösung“, sagte er. Dieses könne in Zukunft als Plattform für all jene genutzt werden, die dokumentieren wollen, dass sie nicht zu einer Organspende bereit sind.
Geführt wird das neue Onlineportal vom Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Dessen Präsident Karl Broich kündigte am Montag an, die Zahl der erfassten Spendenwilligen jedes Jahr zur Veröffentlichen. Er betonte zudem, dass das Register „höchsten Anforderungen an die Datensicherheit“ genüge.
Patientenschützer kritisierten das neue Register als zu umständlich. Die Registrierung über die Online-Funktion des Personalausweises sei für Menschen mit wenig Internet-Erfahrung eine zu hohe Hürde, erklärte die Deutsche Stiftung Patientenschutz.
© AFP