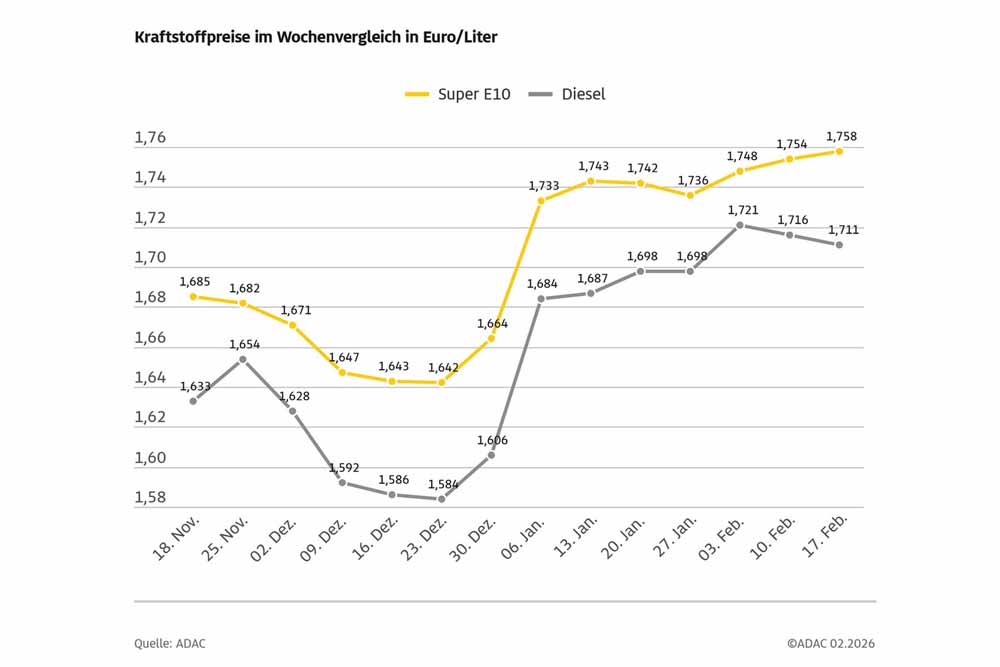Immer höhere Ausgaben für Soziales, Klimaschutz und die Unterbringung von Flüchtlingen, kein Geld mehr für marode Straßen, Schulen und Feuerwehren: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund schlägt angesichts von erwarteten massiven Finanzlöchern in den Kommunen Alarm und fordert ein Ende von Sozialleistungserhöhungen ohne Gegenfinanzierung. „Wir prognostizieren für 2024 ein Defizit von zehn Milliarden Euro“, sagte Verbandspräsident Uwe Brandl (CSU) am Mittwoch in Berlin.
Städten und Gemeinden fehle seit Jahren Geld, um zu investieren, die Auswirkungen würden immer deutlicher sichtbar, betonte Brandl. Viele Aufgaben könnten die Kommunen mit den derzeit zur Verfügung stehenden Mitteln „nicht gänzlich erfüllen“.
Die Infrastruktur etwa bei Straßen und öffentlichen Gebäuden weise „immensen Sanierungsbedarf“ auf, betonte Brandl. Und auch für die kommenden Jahre rechnet der Städtebund mit erheblichen Finanzierungslücken, wie aus dem am Mittwoch vorgestellten Jahresbericht hervorgeht. 2025 fehlen demnach 8,6 Milliarden Euro, 2026 noch 8,2 Milliarden.
Vor allem die Sozialkosten belasten Städte und Gemeinden finanziell. In diesem Bereich seien die Ausgaben mit mehr als 70 Milliarden Euro pro Jahr „überbordend“ geworden, sagte Brandl. Damit habe sich der Betrag seit 2005 mehr als verdoppelt. Bis 2025 wird mit einem Anstieg auf 80 Milliarden Euro gerechnet.
Der Rückstand bei Investitionen in die Infrastruktur betrage dagegen derzeit 166 Milliarden Euro. Neben maroden Straßen und Schulen – die zusammen mehr als die Hälfte davon ausmachen – werde für Verwaltungsgebäude, Sportstätten und Feuerwehren dringend Geld gebraucht.
Brandl plädierte dafür, kommunale Ausgabenblöcke auf den Prüfstand zu stellen und zu priorisieren. Gerade im Sozialen sei „enormes Potenzial vorhanden, um Geld einzusparen, ohne Menschen in Not zu bringen“, sagte Brandl und nannte einkommensunabhängige Hilfen bei der Schulwegbegleitung und bei Pflegeleistungen als Beispiele für Einsparmöglichkeiten.
Der Verbandschef warnte auch davor, Leistungsversprechen zu machen, ohne aufzuzeigen, wie diese finanziert werden sollen. „Das ist aus der Zeit gefallen“, sagte Brandl, der auch Erster Bürgermeister im niederbayerischen Abensberg ist. „Wir müssen den Menschen klar signalisieren, dass nicht alles, was wünschenswert ist, kurzfristig oder auch nur mittelfristig finanzierbar sein wird.“ Der Staat könne nur das verteilen, was er vorher an Steuern eingenommen habe.
Auch die Versorgung und Unterbringung von Geflüchteten bereiten den Kommunen weiterhin finanziell und organisatorisch große Sorgen. Der neue Hauptgeschäftsführer des Städtebunds, André Berghegger (CDU), forderte Bund und Länder auf, alle Kosten zu übernehmen, die in diesem Zusammenhang entstehen. Vielerorts gebe es kaum oder keine Unterbringungsmöglichkeiten mehr, ehrenamtliche Helfer seien „an der Belastungsgrenze angekommen und erschöpft“.
Berghegger forderte, dass Geflüchtete erst in die Kommunen verteilt werden sollten, wenn sie eine klare Bleibeperspektive hätten. Der weitere Zuzug müsse geordnet, gesteuert und begrenzt werden, damit die Kommunen wieder „Luft zum atmen“ hätten, betonte er.
Der Verband fordert auch eine grundgesetzliche Verankerung des sogenannten „Konnexitätsprinzips“, nach dem Leistungen nur von der Ebene – etwa den Kommunen – bezahlt werden, die sie zuvor beschlossen hat. „Zurzeit haben wir vielfach die Situation, dass der Bund Leistungen beschließt, die durch die Kommunen dann zu finanzieren sind“, betonte Brandl. Das schnüre den Kommunen die Luft ab.
Außerdem müsse der Bund Förderprogramme neu ausrichten und unbürokratischer nutzbar machen, fordert der Verband. Den Kommunen solle ein höherer Anteil der Umsatzsteuer zukommen.
© AFP